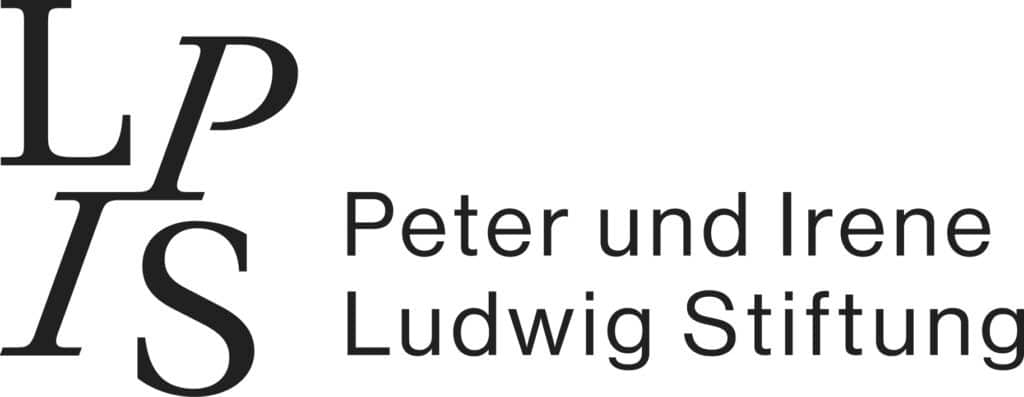Schnittstellen zur Kultur
Im ersten großen Ausstellungsraum sind Werke versammelt, die den Übergang von der Natur zur Kultur beschreiben. Zu den zentralen Arbeiten gehört das Bild: „Einige landwirtschaftliche Geräte“ (1983) von Julian Schnabel (*1951 in New York, lebt und arbeitet in New York).
Auf einer mit rotbraun-erdiger Farbe getränkten, zusammengenähten Plane hat Schnabel zwei monumentale Zeichen flüchtig skizziert. Auf der rechten Seite ist eine Art hochkant gestellte Astgabel zu sehen, die durch Querstreben und Spitze wie eine Egge wirkt, aber auch an eine zeltartige Urbehausung oder einen Schiffsbug erinnert. Auf der linken Seite ist ein Gerät mit angedeuteten Rädern zu erkennen und einem nach oben führenden Bügel; hier wird die Assoziation an einen historischen Pflug geweckt. Durch Verweise auf Rad, Zelt und Boot greift Schnabel archaische Symbole der Kulturgeschichte auf. Mit wenigen Strichen skizziert er die menschliche Evolution von den in Zelten lebenden Nomaden bis zum Beginn der ersten Landwirtschaft, in der die Kunst des Säens und Pflanzens durch eine immer höher entwickelte Technik perfektioniert wurde. Der weite Bogen der Konnotationen reicht von den Zeichen für kulturelle Urformen bis zum Rad als Metapher des technischen Fortschrittes. Ganz nebenbei führt Schnabel den Betrachter an die Wurzeln der Zivilisation und erinnert daran, dass die menschliche Kultur ihren Ursprung dem Kultivieren verdankt, dass das, was wir „Kultur“ nennen nichts anders als „Ackerbau“ bedeutet.
Auch Kcho (*1970 in Isla de Pinos, Kuba, lebt und arbeitet in Havanna) und Thomas Virnich (*1957 in Eschweiler, lebt und arbeitet in Mönchengladbach) setzen sich mit einfachen Gerätschaften aus Naturmaterialien auseinander. Während Virnich sich in seiner für die 1980er Jahre typischen Technik einem Gegenstand durch Abformung und Umsetzung in verschiedenen Materialien nähert und hier einen hohlen Baumstamm in Ton abformt und dabei aus der Naturform ein Tongefäß gewinnt, das an Frühkulturen erinnert, führt Kcho den Betrachter der „Machetenleiter“ (1991) in die Geschichte Kubas. Das auf den ersten Blick scheinbar harmlose Kletterinstrument, das die funktionalen Möglichkeiten einer Strickleiter assoziieren läßt, wie etwa waghalsige Befreiungsaktionen, entpuppt sich auf den zweiten Blick als gefährliches Foltergerät. Die Trittstufen sind aus den rostigen Klingen der säbelartigen Buschmesser gebildet, mit denen zur Kolonialzeit in Kuba Sklaven das Zuckerrohr ernteten. Kcho verweist so auf das bittere Los der farbigen Bevölkerung, aber auch der Landarbeiter in Kuba und die Unentrinnbarkeit ihres Schicksals.
In den Bildern von Siron Franco (*1947 in Goiás lebt und arbeitet in São Paulo), Donald Baechler (*1956 in Hartford, Connecticut, lebt und arbeitet in New York), László Fehér (*1953 in Székesfehérvár, Ungarn, lebt und arbeitet in Budapest und Tác) und Huang Yongping (*1954 in Xiamen, Fujian Province, lebt und arbeitet in Paris) dient die vordergründig ursprüngliche Naturdarstellung zur Visualisierung grundlegender menschlicher Befindlichkeiten. Das emblematisch komprimierte Bild eines in der Umzingelung einer Schlange ruhenden Tapiers bei Franko steht für das labile Gleichgewicht zwischen vermeintlicher Friedfertigkeit und latenter Gefahr. Mit einfacher, kindlich anmutender Bildsprache symbolisiert Baechlers „Wiener Wald“ die Einsamkeit der menschlichen Existenz. László Fehér malt die sandige Ebene um das Dorf Tác als Seelenlandschaft und Huang Yongping collagiert das Gemälde, das im Stil Millets eine sich auf dem Feld ausruhende Bäuerin zeigt, um auf den drängenden Aufbruchswillen einer neuen Generation in China Anfang der 1980er aufmerksam zu machen.
Natur und Kontemplation
Der Übergangsraum vor der Bibliothek ist Werken gewidmet, die sich mit dem kontemplativen Effekt von Natur und Kunst befassen.
In der Mitte der Halle befindet sich ein 15 Meter langer, mit Steinen ausgelegter Weg von Richard Long (*1945 in Bristol, lebt und arbeitet in Bristol). Die eine Bodenhälfte von „Cornwall Carrara Line“ (1988) ist mit kleinen, glatten Kieselsteinen aus weißem Carrara-Marmor belegt – in der anderen Hälfte ragt schroff-gezackter Cornwall-Schiefer auf. Beide Steinsorten erinnern an die jeweilige Landschaft, aus der sie stammen. So entsteht eine imaginäre Linie zwischen der sanften Hügellandschaft der Toskana und dem rauen Gebirge Englands. Die Wegform der Bodenarbeit suggeriert eine Wanderung von England nach Italien. Die sorgfältig ausgelegten Steine, die an asiatische Steingärten denken lassen, verweisen auf eine spirituell motivierte, der tieferen Erkenntnis gewidmete, Wanderschaft.
Auch in Michael Bibersteins (*1948 in Solothurn, lebt und arbeitet in Sintra, Portugal) dreiteiligem Gemälde geht es um einen Zustand der innerlichen Kontemplation. Einer satt-schwarzen monochromen Fläche auf der linken Seite folgen zwei Leinwände, die in braun-grauer Farbgebung eine Berglandschaft andeuten. Wie von Nebelschleiern umhüllt befindet sich das Dargestellte im Prozess des Zerfließens und der Auflösung, bis letztlich nur das unbestimmte, nicht fassbare Gefühl von Weite und sublimer Stille bleibt.
Mit der Abwesenheit von Bildern spielt auch Betty Leirners (*1959 São Paolo, lebt und arbeitet in Basel) Kurzfilm „Two Lovers“ (2000). Er zeigt mit dokumentarischer Genauigkeit zwei Kraniche, die in den Gewässern des Flusses Kamogawa bei Kyoto mit großer Gelassenheit fischen und einander dabei aus der Entfernung interessiert beäugen. Die schwarz-weiße Fassung des Films unterstreicht das Schlichte und Unspektakuläre der Szene. Die Ruhe der eleganten Vögel, deren Füße von Zeit zu Zeit das Wasser geradezu zärtlich berühren, steht im deutlichen Kontrast zum gleichmäßigen Treiben des unaufhörlich fließenden Elements, dessen Reflexe und Lichtpunkte vibrierende Grauabstufungen erzeugen. Das Wasser erscheint unergründlich, alle definierten Formen scheinen sich aufzulösen. Ein in Abständen eingeblendeter weißer Balken radikalisiert diesen Auflösungsprozess und führt zur vollkommenen Abwesenheit von Bildmotiven. Leirners so genanntes Video-Poem ist eine Metapher für die Beziehung von Leben (fließender Strom des Kamogawa) und Liebe (vollendete Beschaulichkeit der beiden Kraniche).
Noch einen Schritt weiter gehen Gotthard Graubner (*1930 in Erlbach,Vogtland, lebt und arbeitet in Düsseldorf ) und Joachim Bandau (*1936 in Köln, lebt und arbeitet in Aachen und Stäfa, Schweiz). Während Bandau aus übereinander gelagerten Pigmentschleiern tiefschwarze Farbfelder von geballter Kraft entstehen lässt, schafft Graubner seit den frühen 1960ern in Farbe getränkte „Kissenbilder“. Das „Dunkelblaue Kissen“ von 1963 lässt Graubners Nähe zu monochromen Malern wie etwa Yves Klein erkennen. Das Volumen des Farbpolsters, der durch wechselnde Intensität und Verdünnung pulsierende Farbrhythmus und die Leuchtkraft und Wirkung auf den Raum verleihen Graubners „Kissen“ eine physische Präsenz und nahezu haptische Körperlichkeit, die sein Werk von anderen Farbfeldmalern unterscheidet.
Den Übergang zu den Kapellenräumen bildet die Arbeit „New York, New Mexiko, Nr. 25“ (1998) von Richard Tuttle (*1941 Rahway/New Jersey, lebt und arbeitet in New York). Die aus der Ferne wie ein Gipfelpanorama wirkenden monochrom graublauen Spitzen vor hellblauem Grund entpuppen sich von Nahem betrachtet als ein raffiniertes Spiel aus Zacken und Dreiecken. Die Arbeit entstammt einer Serie einfacher Farbkompositionen auf dünnen Holzplatten, die teilweise übereinander geklappt sind, so dass sie wie ein Kuvert oder eine Schatulle mit verschlossener Botschaft wirken. Der durch die Überlagerung entstandene Schatten übernimmt die Funktion von Linien bzw. abgetönten Flächen, die mit dem Farbauftrag korrespondieren. Zugleich kommunizieren die Schichtungen mit dem Raum und bestimmen – ähnlich wie das Zusammenspiel von Raumsymmetrie und der davon offensichtlich abweichenden Werkform – die ausgeklügelte Dialektik von Raum und Werk.
Naturstudien und wissenschaftliche Recherche
Die Werke in den kleinen Räumen auf der rechten Seite des Museums reihen sich in die Tradition des Künstlers als Naturforscher ein. Zunächst stellt sich Tunga (*1952 Palmares, Pernambuca, lebt und arbeitet in Rio de Janeiro) als Amateurforscher, Insektenliebhaber und professioneller Sammler von Duftstoffen vor. Anhand der „Mistkäferschatzkiste“ (1992), die aus drei großen Seifenkugeln und drei „Heiligen Scarabaeus Tucurui“-Käfern besteht, erzählt er die Geschichte, wie er im Norden des Amazonas sogenannte Pillendreher durch Eigenkot und Urin einfing, die zu seiner Überraschung während einer längeren Reise die Sammlung seiner Aromen zu drei kopfgroßen Kugeln verarbeitet hatten. Undurchdringbar sind bei Tunga Realität und Imagination, Naturwissenschaft und Phantasie miteinander verwoben.
Seinem Werk zur Seite stehen Wandarbeiten zweier Vertreter des deutsch-französischen Nouveaux Realisme, die in den 1960er Jahren durch die Verwendung von realen Dingen eine Rückbindung der Kunst an das Leben suchten. Zu sehen ist ein Kunststeinrelief von Raoul Ubac (*1910 in Malmedy, gest. 1985), der sich Anfang der 1950er der Informel-Gruppe um Karl Fred Dahmen, Karl-Otto Götz und Ludwig Schaffrath angeschlossen hatte. Daneben hängt ein Objektkasten von Karl Fred Dahmen (*1917 in Stolberg/Rhld, gest. 1981), der zunächst durch die Ecole de Paris inspiriert wurde und ab Mitte der 1960er Jahre Materialbilder schuf, in die er verschiedene Gegenstände integrierte.
Im dahinter liegenden Raum befinden sich zwei Zeichnungen und eine Bronzeskulptur von Nancy Stevenson Graves (*1940 in Pittsfield, Massachusetts, gest. 1995 in New York). „Three snakes“ (1971) wirkt wie eine botanisch-zoologische Illustration, die die markanten, arabeskenhaften Bewegungen von Schlangen zeichnerisch analysiert. „Pleistocene camelus“ (1971), ein Blatt, auf dem zusammengestellte Knochenfunde gezeichnet sind, nimmt den naturwissen-schaftlichen Duktus paläontologischer Studien auf. Die farbige Zeichnung von Kamelknochen, wie auch die Bronze aus Kamelknochen zeugen von der Leidenschaft, mit der sich die Künstlerin seit 1966 dem Thema „Kamele“ widmete. Sie war fasziniert von der urtümlichen Gestalt, dem Ausdruck unerschütterlicher Ruhe und der Ausdauer der Tiere und setzte ihre Kenntnisse über die Kamele in unterschiedlichen Kunstgattungen um.
Neben den Arbeiten der naturwissenschaftlich motivierten „Sammlerin“ Nancy Graves hat ein Gemälde der tschechischen Künstlerin Martina Fojtü seinen Platz gefunden, das die Versammlung der Fauna als biblisches Schöpfungsmotiv darstellt.
Mikro und Makro – Strukturen in der Natur
Das Thema Mikro- und Makrostrukturen wird in den Werken der beiden nonkonformistischen Künstler Ivan Semenovič Čujkov (*1935 in Moskau, lebt und arbeitet in Köln und Moskau) und Olga Černyševa (*1962 in Moskau, lebt und arbeitet in Moskau) angesprochen.
In „Fragment auf Landschafts-Postkarte“ (1987) beschäftigt sich Čujkov konzeptuell mit der Umsetzung eines Naturmotivs in verschiedenen Ausführungen, wie etwa der Fotografie, der Malerei auf Platte und der Kopie auf Leinwand, mit denen gleichzeitig ein Wechsel der Größenverhältnisse verbunden ist.
Černyševa dagegen zeichnet ihre zarten Landschaftsgemälde auf die Seiten mächtiger Tortenstücke. Die Malerei wird Teil einer plastischen Arbeit, die sowohl geometrische Grundform ist, als auch konsumierbares Gut sein soll.
Der zentrale Kapellenraum wird von dem monumentalen Holzschnitt „Großer Waldweg“ (2005/6) von Franz Gertsch (*1930 in Mörigen im Kanton Bern, lebt und arbeitet in Rüschegg bei Burgau) und den „Mori Woods” (1987) von Shigeo Toya (*1947 in Nagano, Japan, lebt und arbeitet in Saitarna) beherrscht.
Das Werk von Franz Gertsch, dem Hauptvertreter des europäischen Fotorealismus, beeindruckt durch eine außerordentliche handwerkliche Könnerschaft. Ab 1986 wandte Gertsch sich der Technik des Holzschnitts zu und begann mit einer monumentalen Serie stiller Naturmotive. „Großer Waldweg“ lässt von Ferne die fotografische Vorlage erkennen. Von Nahem „zerfällt“ das Bildmotiv in eine Vielzahl allerfeinster, filigraner Pünktchen, die den Blick des Betrachters auf den aufwändigen Schaffensprozess, d.h. das Schneiden des kolossalen Druckstockes mit dem kleinsten verfügbaren Hohleisen, lenkt.
„Mori“, wie Toya seine Installationen ab 1984 nannte, bedeutet im Japanischen „Dichter, tiefer Wald“. Die 28 überlebensgroßen, an der Spitze sich verjüngenden Vierkantstämme sind in einem rechtwinkligen Feld aufgebaut. Die minimalistische Strenge der Anordnung steht im deutlichen Kontrast zu den üppig ausgearbeiteten und bemalten Oberflächen. Sie wurden an der Spitze mit Axt und Kettensäge kunstvoll bearbeitet, so dass durch vielerlei Einkerbungen und Einschnitte der Eindruck kristalliner Formen und fossiler Erstarrung entsteht, während der Schaft durch eine ornamentale, fließende Formgebung wie lebendige Materie erstrahlt. Kantige und organische Gestalt, Holz und die gesteinsartige Farbfassung, gleichförmige Reihung und individuelle Unverwechselbarkeit stehen im Spannungsverhältnis zueinander. Für Toya besteht Natur ganz im Sinne der asiatischen Kunsttradition aus dem Kanon der Gegensätze, aus Starre und Lebendigkeit; aus Vielfalt und Gleichartigkeit.
Im Gegensatz zu den beiden Monumentalwerken sind die anderen Werke im gleichen Raum auffallend klein. Ai Wei Wei (*1957 in Beijing, lebt und arbeitet in Beijing) hat mit dadaistischem Gespür für Parodie eine im wahrsten Sinne des Wortes naturnahe Landschaftsdarstellung geschaffen, indem er Kuhfell aufspannte, dessen Fellmuster Assoziationen an eine Hügellandschaft oder Erdformation hervor rufen. Ira Joel Haber (*1947 in Brooklyn New York, lebt und arbeitet in Brooklyn) lässt in seinen Schaukästen vermeintlich bürgerliche Idyllen entstehen. Zu sehen sind hinter Bäumen tief versteckte Einfamilienhäuser, unzugängliche Miniaturwelten, die etwas von der Beengtheit und Isolation dieser scheinbaren Idealwelt verraten.
Eros und Lust – Elemente der Natur
Für die kleinen Räume zur Linken des Gebäudes wurden Arbeiten zusammengestellt, die das Üppige und Überbordende der Natur, das Verspielte und Heitere reflektieren. „Asparagus“ (1979), der im Diorama präsentierte Zeichen-trickfilm von Suzan Pitt (lebt und arbeitet in Los Angeles, Mexiko und auf der Halbinsel von Michigan) ist das Hauptwerk dieser Abteilung. In der für Suzan Pitt typischen, frechen und poppigen Bildsprache handelt der Film von den Triebkräften der Natur und vom Eros als Inspirationsquelle der Kunst.
Gleich daneben sind die Papierarbeiten des Künstlers Kim MacConnel (*1946 in Oklahoma City, Oklahoma, lebt und arbeitet in Escondido, Kalifornien) zu sehen, einem der Pioniere der Stilrichtung „Pattern & Decoration“. Bereits in den frühen 1970ern Jahren begann er farbenprächtige Muster des Kunsthandwerks volkstümlicher Kulturen, aber auch Früchte und florale Formen im Sinne der dekorativen Künste Südfrankreichs aufzugreifen und mit cartoon-artigen Zeichnungen zu kombinieren. Wie die Requisiten einer Performance ranken pralle Wassermelonenornamente von der Decke und dekorieren bunte Fische und Meeresfrüchte die Wand.
Roy Lichtenstein (*1923 in New York, gest. 1997 in New York) entführt den Betrachter in eine sommerliche Flusslandschaft mit bunten Segelboten. Stilisierte breite Pinselstriche aus Schablonen, die Lichtenstein in den Sechzigern als sogenannte „Brushstrokes“ vom Comics entlehnte, kombiniert er mit gestischen Pinselhieben. Der aufgelockerte, entfernt an den Impressionismus erinnernde Malstil lässt dabei eine luftig, leichte Atmosphäre entstehen.
Wie Kim MacConnel gehört auch Brad Davis (*1942 Duluth, Minnesota, lebt und arbeitet in New York) zu der „Pattern & Decoration“-Bewegung. Sein strahlend hellgelbes, mit Patchwork gefasstes Rondo zeigt eine stilisierte, tropisch anmutende Blütenpracht.
Auf andere Weise nähert sich der Künstler Antonio Eligio Fernández Rodriguez Tonel (*1958 in Havanna, lebt und arbeitet in Havanna) dem Thema der dynamischen Natur, die in seinen Zeichnungen mit ironischem Unterton entweder zu Fuß oder auf Rädern daher kommt.
Reisen und Wege
Den Abschluss der Ausstellung bilden Arbeiten, in denen die Natur zur Bühne für beschauliche Reisen und andere Wege wird. Im weiteren Sinne schließt dieser Themenkreis an Richard Longs Steinpfad an, der den Weg der Erkenntnis beschreibt. Der für seine skurrilen Hundeporträts bekannte Fotograf William Wegmann (*1943 in in Holyoke, Massachusetts, lebt und arbeitet in New York) ist mit einem ungewöhnlichen Gemälde vertreten: er präsentiert eine beschaulich anmutende Flusslandschaft mit Kutsche in einem der Romantik verbundenen Malstil.
Diesem dem 19. Jahrhundert verpflichteten Reisebild stehen zwei Arbeiten von Peter Fischli & David Weiss (*1952 in Zürich/*1946 in Zürich, leben und arbeiten in Zürich) gegenüber. In der Blackbox wird ihr Film „Der rechte Weg” (1982/3) gezeigt, der die Reise und philosophischen Naturbeobachtungen der als Bär und Ratte verkleideten Künstler durch die Schweiz zeigt. Im gleichen Jahr entstand auch die Polyethanskulptur „Der Auftrag“ (1983) des Schweizer Künstlerduos. Sie zeigt eine Reise ins Innere der Erde und den Lebensweg als Reise. Auf der einen Seite der Skulptur drängen allerhand Geschöpfe, beladen mit schwerem Gepäck, über eine Wendeltreppe nach oben an die Erdoberfläche, die durch grüne hügelige Wiesen und kleine Häuschen aus der Vogelperspektive dargestellt ist. Auf der anderen Seite zeigt das Gestein als eine Art „Gebärkammer“: wabenartige Formen, gefüllt mit Eiern und Larven, die in einer zweiten Entwicklungsstufe als geschlüpfte blaue Riesenfliegen über rote und blaue Käfer krabbeln. Während die einen Wesen Schritt für Schritt ihrem „inneren Auftrag“ folgen und unter größten Mühen ans Tageslicht streben, zeigt die gegenüberliegende Seite ein farbenprächtiges Gewimmel, das ungerührt und ungestört dem Zyklus von Werden und Vergehen als kreatürlichem „Sein“ folgt.
Kuratiert von Dr. Annette Lagler